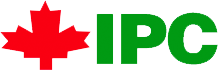Lieferanten von Frequenzumrichter-Komponenten weisen darauf hin, dass in herkömmlichen Frequenzregelungssystemen mit Frequenzumrichtern, Asynchronmotoren und mechanischen Lasten der Motor bei sinkender Lastspannung in den regenerativen Bremszustand wechseln kann. Auch beim Abbremsen (z. B. beim Stillstand) kann die Frequenz abrupt abfallen, wobei der Motor aufgrund seiner Trägheit Energie zurückgewinnt. Die im Getriebe gespeicherte mechanische Energie wird vom Motor in elektrische Energie umgewandelt und über die sechs Freilaufdioden des Wechselrichters zurück in dessen Gleichstromkreis geleitet. Der Wechselrichter arbeitet dabei gleichgerichtet. Wird die Energie im Frequenzumrichter nicht abgeführt, steigt die Spannung des Energiespeicherkondensators im Zwischenkreis an. Bei zu starkem Bremsen oder Hebezeugen kann diese Energie den Frequenzumrichter beschädigen und sollte daher berücksichtigt werden.
Bei Frequenzumrichtern gibt es im Allgemeinen zwei gängigste Verfahren zur Verarbeitung der regenerierten Energie:
(1) Die Dissipation in den künstlich parallel zum Kondensator im Gleichstromkreis geschalteten „Bremswiderstand“ wird als dynamischer Bremszustand bezeichnet;
(2) Wird die Bremsenergie ins Stromnetz zurückgespeist, spricht man von Rückkopplungsbremsung (auch regenerative Bremsung genannt). Eine weitere Bremsmethode ist die Gleichstrombremsung, die zum Einsatz kommt, wenn präzises Parken erforderlich ist oder der Bremsmotor vor dem Anfahren aufgrund äußerer Einflüsse unregelmäßig läuft.
Viele Experten haben die Konstruktion und Anwendung der Bremsung von Frequenzumrichtern in Büchern und Publikationen erörtert, insbesondere in jüngster Zeit gab es zahlreiche Artikel zum Thema „Bremsung mit Energierückkopplung“. Der Autor stellt heute eine neue Bremsmethode vor, die die Vorteile des Vierquadrantenbetriebs mit „Rückkopplungsbremsung“ und hoher Betriebseffizienz sowie die Vorteile der „Bremsung mit reduziertem Energieverbrauch“ für ein emissionsfreies Stromnetz und hohe Zuverlässigkeit vereint.
Energieverbrauch beim Bremsen
Die Methode, bei der der Bremswiderstand im Gleichstromkreis zur Absorption der regenerativen elektrischen Energie des Motors eingesetzt wird, wird als energieverbrauchendes Bremsen bezeichnet.
Seine Vorteile liegen in der einfachen Konstruktion, der fehlenden Belastung des Stromnetzes (im Vergleich zur Rückkopplungsregelung) und den geringen Kosten. Der Nachteil besteht in der geringen Betriebseffizienz, insbesondere bei häufigem Bremsen, was einen hohen Energieverbrauch und eine Erhöhung der Kapazität des Bremswiderstands zur Folge hat.
Im Allgemeinen sind Frequenzumrichter mit niedriger Leistung (unter 22 kW) mit einer integrierten Bremseinheit ausgestattet, die lediglich einen externen Bremswiderstand benötigt. Frequenzumrichter mit hoher Leistung (über 22 kW) benötigen hingegen externe Bremseinheiten und Bremswiderstände.
Feedback-Bremsung
Um eine Energierückkopplungsbremsung zu erreichen, sind Bedingungen wie Spannungsregelung mit gleicher Frequenz und Phase sowie Stromrückkopplungsregelung erforderlich. Dabei wird aktive Wechselrichtertechnologie eingesetzt, um die zurückgewonnene elektrische Energie in Wechselstrom mit gleicher Frequenz und Phase wie das Stromnetz umzuwandeln und ins Netz zurückzuspeisen. Dadurch wird die Bremswirkung erzielt.
Der Vorteil der Rückkopplungsbremsung liegt darin, dass sie in vier Quadranten funktioniert und die elektrische Energierückführung die Effizienz des Systems verbessert. Ihre Nachteile sind:
(1) Dieses Rückkopplungsbremsverfahren kann nur bei stabiler Netzspannung und geringer Fehleranfälligkeit (Netzspannungsschwankungen von maximal 10 %) angewendet werden. Denn während des Bremsvorgangs der Stromerzeugung kann es bei einer Spannungsfehlerzeit im Stromnetz von mehr als 2 ms zu Kommutierungsfehlern und damit zu Bauteilschäden kommen.
(2) Bei der Rückkopplung kommt es zu Oberwellenbelastungen im Stromnetz.
(3) Die Steuerung ist komplex und die Kosten sind hoch.
Neues Bremsverfahren (Kondensator-Rückkopplungsbremsung)
Hauptschaltungsprinzip
Der Gleichrichterteil verwendet eine herkömmliche, nicht steuerbare Brückengleichrichterschaltung, die Filterschaltung einen universellen Elektrolytkondensator und die Verzögerungsschaltung entweder einen Schütz oder einen Thyristor. Die Lade- und Rückkopplungsschaltung besteht aus einem Leistungs-IGBT, einer Lade- und Rückkopplungsdrossel L und einem großen Elektrolytkondensator C (mit einer Kapazität von einigen Zehntelmetern, die je nach Betriebssystem des Frequenzumrichters angepasst werden kann). Der Wechselrichterteil besteht aus einem Leistungs-IGBT. Die Schutzschaltung besteht aus einem IGBT und einem Leistungswiderstand.
1) Betriebszustand der Stromerzeugung durch Elektromotoren
Die CPU überwacht die Eingangswechselspannung und die Gleichspannung (μd) in Echtzeit und entscheidet, ob ein Ladesignal an VT1 gesendet werden soll. Sobald μd den entsprechenden Gleichspannungswert (z. B. 380 V AC – 530 V DC) der Eingangswechselspannung überschreitet, schaltet die CPU VT3 ab und lädt den Elektrolytkondensator C durch Impulsleitung von VT1. Dabei werden Drossel L und Elektrolytkondensator C getrennt, um einen sicheren Betrieb des Kondensators zu gewährleisten. Nähert sich die Spannung am Elektrolytkondensator C einem kritischen Wert (z. B. 370 V), während sich das System noch im Stromerzeugungszustand befindet und elektrische Energie kontinuierlich über den Wechselrichter in den Gleichstromkreis zurückgespeist wird, greift die Sicherheitsschaltung ein, um den Energieverbrauch zu reduzieren (Widerstandsbremsung). Dies steuert das Ein- und Ausschalten von VT3 und ermöglicht so die Nutzung überschüssiger Energie über den Widerstand R. Im Normalfall tritt dieser Fall nicht auf.
(2) Betriebszustand des Elektromotors
Sobald die CPU erkennt, dass das System nicht mehr geladen wird, leitet sie VT3 pulsierend und erzeugt so kurzzeitig eine positive Spannung links und eine negative Spannung rechts am Reaktor L. Zusammen mit der Spannung am Elektrolytkondensator C kann die Energie vom Kondensator in den Gleichstromkreis zurückgeführt werden. Die CPU steuert die Schaltfrequenz und das Tastverhältnis von VT3 durch Messung der Spannung am Elektrolytkondensator C und der Spannung im Gleichstromkreis. Dadurch regelt sie den Rückkopplungsstrom und stellt sicher, dass die Gleichstromspannung ν<sub>d</sub> nicht zu hoch wird.
Systemschwierigkeiten
(1) Auswahl der Reaktoren
(a) Wir betrachten die Besonderheiten der Betriebsbedingungen und nehmen an, dass ein bestimmter Fehler im System auftritt, der dazu führt, dass die vom Motor getragene potenzielle Energielast ungehindert beschleunigt und abfällt. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Motor im Stromerzeugungsbetrieb.
Die zurückgewonnene Energie wird über sechs Freilaufdioden in den Gleichstromkreis zurückgeführt, wodurch sich ∆d erhöht und der Wechselrichter schnell in den Ladezustand versetzt wird. In diesem Zustand ist der Strom sehr hoch. Daher muss der gewählte Durchmesser des Drosseldrahts ausreichend groß sein, um den Strom in dieser Phase zu leiten.
(b) Um im Rückkopplungszweig vor der nächsten Ladung des Elektrolytkondensators möglichst viel elektrische Energie freizusetzen, reicht ein herkömmlicher Eisenkern (Siliziumstahlblech) nicht aus. Ein Eisenkern aus Ferrit ist die beste Wahl. Der oben genannte Stromwert verdeutlicht die Größe dieses Eisenkerns. Es ist nicht bekannt, ob ein so großer Ferrit-Eisenkern auf dem Markt erhältlich ist. Selbst wenn, dürfte er sicherlich nicht sehr günstig sein.
Der Autor schlägt daher vor, für jeden Lade- und Rückkopplungskreis einen Reaktor zu verwenden.
(2) Schwierigkeiten bei der Kontrolle
(a) Im Gleichstromkreis des Frequenzumrichters liegt die Spannung ν<sub>d</sub> üblicherweise über 500 V DC, während die Spannungsfestigkeit des Elektrolytkondensators C nur 400 V DC beträgt. Dies zeigt, dass die Steuerung dieses Ladevorgangs nicht mit der Steuerungsmethode der Energiebremsung (Widerstandsbremsung) vergleichbar ist. Der momentane Spannungsabfall an der Drosselspule beträgt ν<sub>c</sub> = ν<sub>d</sub> - ν<sub>L</sub>, und die momentane Ladespannung des Elektrolytkondensators C beträgt ν<sub>c</sub> = ν<sub>d</sub> - ν<sub>L</sub>. Um sicherzustellen, dass der Elektrolytkondensator in einem sicheren Bereich (≤ 400 V) arbeitet, ist es notwendig, den Spannungsabfall ν<sub>L</sub> an der Drosselspule effektiv zu steuern. Dieser hängt wiederum von der momentanen Änderungsrate der Induktivität und des Stroms ab.
b) Während des Rückkopplungsprozesses muss außerdem verhindert werden, dass die Entladung elektrischer Energie aus dem Elektrolytkondensator C eine übermäßige Gleichspannung über die Drosselspule verursacht, die zu einem Überspannungsschutz im System führt.
Hauptanwendungsszenarien
Gerade wegen der Überlegenheit dieser neuen Bremsmethode (Kondensator-Rückkopplungsbremsung) für Frequenzumrichter haben viele Anwender in letzter Zeit vorgeschlagen, ihre Anlagen entsprechend ihren Eigenschaften mit diesem System auszustatten. Mit der Erweiterung des Anwendungsbereichs von Frequenzumrichtern ergeben sich für diese Technologie große Entwicklungsperspektiven. Sie wird insbesondere in Branchen wie Förderanlagen (für Personen- oder Materialtransport), Schrägförderwagen (ein- oder zweirohrig) und Hebezeugen eingesetzt. Energierückkopplungsvorrichtungen können generell in Situationen verwendet werden, in denen sie erforderlich sind.