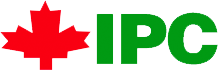In den letzten Jahren hat die Entwicklung des Industriezeitalters die Anwendung von Energierückgewinnungstechnologien immer weiter verbreitet. In Aufzügen, Grubenaufzügen, Hafenkränen, Fabrikzentrifugen, Ölfeldpumpen und vielen anderen Bereichen treten ständig Änderungen der Lastpotenzial- und kinetischen Energie auf. Beispielsweise verringert sich die Energie beim Entladen schwerer Güter durch Aufzüge, Kräne und andere mechanische Geräte, und auch die kinetische Energie von Zentrifugen nimmt im Stillstand ab. Da Energie laut Energieerhaltungssatz nicht aus der Luft verschwindet, stellt sich die Frage: Wohin geht dieser Teil der Energie? Die Antwort: Er wird vom Motor in erneuerbaren Strom umgewandelt. Bei Geräten mit Frequenzumrichtern wird dieser Teil des Stroms jedoch üblicherweise durch die Umwandlung des Bremswiderstands in Wärme verloren.
Wenn ein Gerät diesen Teil des erneuerbaren Stroms zur Rückspeisung ins Netz nutzt, kann es diesen Strom einsparen und so den Energieverbrauch senken. Ein solches Produkt ist ein Energierückkopplungsgerät. Es nutzt Leistungselektronik und wandelt den von den oben genannten Geräten im Betrieb erzeugten erneuerbaren Strom in synchronen Wechselstrom um, der ins Netz zurückgespeist wird, um so Strom zu sparen.
In herkömmlichen Frequenzregelungssystemen, bestehend aus Frequenzumrichtern, Asynchronmotoren und mechanischen Lasten, kann sich der Motor im Zustand der regenerativen Energieerzeugung und Bremsung befinden, wenn die vom Motor angetriebene Last entladen wird. Oder wenn der Motor von hoher auf niedrige Drehzahl abbremst (einschließlich Stillstand), kann die Frequenz zwar sinken, aber aufgrund der mechanischen Trägheit des Motors kann er sich in einem Zustand der regenerativen Energieerzeugung befinden, und die im Übertragungssystem gespeicherte mechanische Energie wird vom Motor in Elektrizität umgewandelt, die über die sechs Gleichstromdioden des Umrichters in dessen Gleichstromkreis zurückgeführt wird.
Bei Frequenzumrichtern gibt es im Allgemeinen zwei gängigste Methoden zur Verarbeitung erneuerbarer Energien:
(1) dissipiert in den „Bremswiderstand“, der parallel zu dem künstlich in den Gleichstromkreis geschalteten Kondensator geschaltet ist, was als dynamischer Bremszustand bezeichnet wird;
(2) Um wieder ins Stromnetz einzuspeisen, spricht man vom Rückkopplungsbremszustand (auch regenerativer Bremszustand genannt). Zusätzlich gibt es ein Bremsverfahren, die sogenannte Gleichstrombremsung, die in Situationen eingesetzt werden kann, die ein präzises Parken oder eine unregelmäßige Rotation der Motorbremse vor dem Anfahren aufgrund externer Faktoren erfordern.
Energiebremse
Die Nutzung des im Gleichstromkreis vorhandenen Bremswiderstands zur Absorption erneuerbarer elektrischer Energie des Motors wird als energieverbrauchendes Bremsen bezeichnet. Zu seinen Vorteilen zählen der einfache Aufbau, die Vermeidung von Netzverschmutzung (im Vergleich zur Rückkopplungsbremsung) und die geringen Kosten. Der Nachteil besteht in der geringen Betriebseffizienz, insbesondere bei häufigem Bremsen, da dies einen hohen Energieverbrauch und eine erhöhte Kapazität des Bremswiderstands zur Folge hat.
Im Allgemeinen verfügen Frequenzumrichter mit geringer Leistung (unter 22 kW) über eine integrierte Bremseinheit; es muss lediglich ein Bremswiderstand hinzugefügt werden. Frequenzumrichter mit hoher Leistung (über 22 kW) benötigen hingegen eine externe Bremseinheit mit Bremswiderstand.
Rückkopplungsbremse
Um eine Energierückkopplungsbremsung zu erreichen, sind Spannungs-, Frequenz- und Phasenregelung, Rückkopplungsstromregelung und weitere Bedingungen erforderlich. Dabei wird eine aktive Umkehrtechnologie eingesetzt, um den ins Netz eingespeisten erneuerbaren Strom mit der gleichen Frequenz und Phase als Wechselstrom zurückzuspeisen und so die Bremswirkung zu erzielen.
Der Vorteil der Rückkopplungsbremsung liegt darin, dass sie in allen vier Quadranten betrieben werden kann und die elektrische Energierückführung die Effizienz des Systems verbessert. Ihre Nachteile sind:
(1) Dieses Rückkopplungsbremsverfahren kann nur bei einer stabilen und wenig ausfallgefährdeten Netzspannung (Netzspannungsschwankung maximal 10 %) eingesetzt werden. Bei einem Netzspannungsausfall von mehr als 2 ms während des Bremsvorgangs der Stromerzeugung kann es zu Phasenüberschlägen und damit zu Schäden am Gerät kommen.
(2) Bei der Rückkopplung kommt es zu einer harmonischen Verschmutzung des Netzes.
(3) Komplexe Steuerung, hohe Kosten.
Mit dem rasanten Fortschritt in Forschung und Anwendung von Frequenzumrichtern im In- und Ausland, insbesondere universellen Frequenzumrichtern, die in der industriellen Produktion weit verbreitet sind, wird die Energierückkopplungstechnologie immer häufiger wiederverwendet werden.