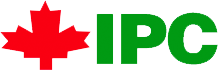Anbieter energiesparender Aufzugsanlagen weisen darauf hin, dass Energieeinsparung und Umweltschutz angesichts des stetig wachsenden Umweltbewusstseins in China zu einer grundlegenden nationalen Politik mit praktischer Bedeutung geworden sind. In der heutigen, zunehmend wettbewerbsintensiven Aufzugsbranche sind die Einführung neuer Technologien, höhere Geschwindigkeiten und die Bewältigung größerer Traglasten die wichtigsten Aspekte, die die Produktvorteile hervorheben. Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass auch die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile von Aufzügen nach ihrer Inbetriebnahme wichtige Kaufkriterien darstellen.
1. Grundlegender Aufbau und Betriebszustand von Aufzügen
1. Grundstruktur eines Aufzugs
Heutzutage bestehen Aufzüge hauptsächlich aus Antriebsmaschinen, Führungssystemen, Kabinensystemen und Türsystemen. Sie umfassen außerdem ein Gewichtsausgleichssystem, ein elektrisches Antriebssystem, ein elektrisches Steuerungssystem, ein Sicherheitssystem usw. Diese Komponenten sind im Schacht bzw. im Maschinenraum des Gebäudes installiert. Üblicherweise wird ein Stahlseilantrieb verwendet, bei dem das Stahlseil um das Antriebsrad gewickelt ist und Kabine und Gegengewicht an beiden Enden verbindet. Die Antriebsmaschine treibt das Antriebsrad an, um die Kabine anzuheben und abzusenken.
2. Analyse des Betriebszustands des Aufzugs:
Beim Aufwärtsfahren verbraucht der Aufzug Energie, beim Abwärtsfahren gibt er Energie ab. Die vom Fahrantrieb gezogene Last setzt sich aus der Fahrgastkabine und dem Gegengewicht zusammen. Um die Zuglast auszugleichen, ist ein Gleichgewicht erst erreicht, wenn die Kabinenlast 50 % ihrer Nennlast erreicht (beispielsweise bei einer Traglast von 1050 kg und etwa 7 Fahrgästen). Obwohl sich dadurch der Spitzenwert des Energieverbrauchs ändert, bleibt der durchschnittliche Energieverbrauch unverändert. Im praktischen Betrieb tritt das Gegengewicht nur selten auf, da das Gewicht der Kabine plus das Gewicht der Fahrgäste genau dem Gegengewicht entspricht. Daher befindet sich der Aufzug im Betrieb grundsätzlich in einem unausgewogenen Zustand. Es ist zudem sehr wahrscheinlich, dass die Kabine bei vielen Fahrgästen abwärts und bei wenigen oder keinen Fahrgästen wieder ansteigt. Tritt die erste Situation ein, wenn die potenzielle Energie der Fahrgäste freigesetzt wird, und die zweite Situation, wenn die potenzielle Energie des Gegengewichts freigesetzt wird, so ist die Drehzahl aufgrund der potenziellen Last höher als die Synchrondrehzahl (n > n₀), d. h. wenn n > n₀, ist die Schlupfrate s = (n₀ - n)/n₀ < 0. Die vom Rotor induzierte elektromotorische Kraft kehrt sich um, die Statorwicklung speist elektrische Energie ins Netz zurück, und die Drehrichtung (T) ist der Drehrichtung entgegengesetzt. Der Motor speist nicht nur elektrische Energie zurück, sondern erzeugt auch ein mechanisches Bremsmoment an der Welle. Aufgrund der Irreversibilität des AC/DC-Gleichrichters des Frequenzumrichters des Aufzugs kann die erzeugte elektrische Energie jedoch nicht ins Netz zurückgespeist werden. Dies führt zu einem Spannungsanstieg an beiden Enden des Hauptstromkreiskondensators und zur Entstehung einer Überspannung. Um eine Kondensatorüberspannung zu verhindern, verwenden Aufzüge mit variabler Frequenz üblicherweise Widerstände, um die in den Kondensatoren gespeicherte elektrische Energie zu verbrauchen. Während des Aufzugsbetriebs geben diese Widerstände große Mengen an Wärme ab (mit einer Oberflächentemperatur von über 100 °C). Diese Energieverschwendung macht 25 % bis 45 % des gesamten Stromverbrauchs des Aufzugs aus. Der Energieverbrauch der Widerstände reduziert nicht nur die Systemeffizienz, sondern erzeugt auch eine große Wärmemenge, die den Staubtransport in der Luft des Maschinenraums beschleunigt, statische Elektrizität adsorbiert und die Umgebung des Aufzugssteuerschranks stark beeinträchtigt. Gleichzeitig verkürzt der Temperaturanstieg die Lebensdauer der Originalkomponenten des Aufzugs erheblich, und deren Alterung und Ausfall schreiten fort. Um die Temperatur im Maschinenraum auf Raumtemperatur zu senken und durch hohe Temperaturen verursachte Aufzugsstörungen zu vermeiden,Nutzer müssen Klimaanlagen oder Ventilatoren mit hohem Abluftvolumen installieren; in Maschinenräumen mit hohem Aufzugsstrombedarf müssen oft mehrere Klimaanlagen und Ventilatoren gleichzeitig in Betrieb genommen werden. Machen Sie Aufzüge und Klimaanlagen zu den größten Energieverbrauchern.
2. Funktionsprinzip der Aufzugsenergierückgewinnungsvorrichtung
Um in Aufzügen Energie zu sparen, ist die Nutzung der von der Antriebsmaschine erzeugten elektrischen Energie während des Stromerzeugungsbetriebs entscheidend. Die vom Bremswiderstand erzeugte Energie wird anschließend durch Wechselrichter wieder in Wechselstrom umgewandelt, anderen elektrischen Geräten zugeführt oder ins Stromnetz eingespeist. Der Wirkungsgrad der Energieumwandlung liegt im Allgemeinen bei etwa 85 %, und der Energieverbrauch des oben genannten Bremswiderstands macht 25 % bis 45 % des gesamten Stromverbrauchs des Aufzugs aus. Je höher das Stockwerk oder je schneller der Aufzug fährt, desto deutlicher wird der Rückkopplungseffekt der elektrischen Energie. Die Hauptschaltung des Energierückkopplungssystems besteht im Wesentlichen aus Filterkondensatoren, drei IGBT-Vollbrücken, Serieninduktivitäten und Peripherieschaltungen. Der Eingang des Aufzugs-Energierückkopplungssystems ist mit dem DC-Zwischenkreis des Aufzugs-Frequenzumrichters verbunden, der Ausgang mit dem Stromnetz. Im elektrischen Betrieb der Antriebsmaschine sind alle Schalter des Energierückkopplungssystems ausgeschaltet. Im Stromerzeugungsbetrieb steigt die Pumpenspannung am DC-Zwischenkreis des Frequenzumrichters an und erfüllt die weiteren Bedingungen für die Wechselrichterumwandlung. Anschließend setzt das Energierückkopplungssystem ein. Da die aktuelle Energie des Gleichstromnetzes in das Netz zurückgespeist wird, sinkt die Gleichstrom-Busspannung, bis sie auf den Sollwert zurückfällt, und das System schaltet sich ab.
Der aktive Wechselrichter, der Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, ist das Herzstück der Energierückführung im Aufzug. Ziel ist es, die von der Traktionsmaschine während der Stromerzeugung erzeugte elektrische Energie über den Wechselrichter zurückzuleiten, um Energie zu sparen und die durch den Wechselrichterausgang verursachte Belastung des Stromnetzes zu vermeiden. Daher müssen bei der Energierückführung aus der Traktionsmaschine vier Regelungsbedingungen hinsichtlich Phase, Spannung und Stromstärke erfüllt sein:
a) Das System kann nicht willkürlich gestartet werden. Der Wechselrichter startet und liefert nur dann Energierückkopplung, wenn die Gleichspannung im Zwischenkreis den eingestellten Wert überschreitet;
b) Der Wechselrichterstrom muss den Bedarf an Rückkopplungsleistung decken und darf den vom Wechselrichterkreis zugelassenen Maximalstrom nicht überschreiten;
c) Der Wechselrichterprozess muss mit der Phase des Stromnetzes synchronisiert werden, und die Energierückführung in das Stromnetz sollte am Hochspannungsende des Stromnetzes erfolgen;
d) Die durch den Wechselrichterprozess verursachte Verschmutzung des Stromnetzes soll so weit wie möglich minimiert werden.
3. Hardware-Design des Aufzugsenergierückkopplungssystems
1. Wechselrichterschaltung
Im Wechselrichterkreis wird der Gleichstrom, der während des Betriebs der Antriebsmaschine im Stromerzeugungszustand auf der Zwischenkreisseite des Aufzugsfrequenzumrichters gespeichert ist, durch Ansteuern eines Schalters in Wechselstrom umgewandelt. Er ist der Hauptkreis des Aufzugsenergierückführungssystems und weist je nach Wechselrichtertyp unterschiedliche Strukturen auf. Durch Ansteuern des Schalters wird die während des Betriebs der Antriebsmaschine im Stromerzeugungszustand auf der Zwischenkreisseite des Aufzugsfrequenzumrichters gespeicherte Gleichleistung in Wechselstrom umgewandelt. Innerhalb eines solchen Kreises können die oberen und unteren Schalter desselben Brückenzweigs nicht gleichzeitig leiten; die Schaltzeit und -dauer jedes Schalters werden gemäß dem Wechselrichter-Regelalgorithmus gesteuert.
2. Netzsynchronisationsschaltung
Die Phasensynchronisationssteuerung ist entscheidend dafür, ob der Aufzug die Energie des DC-Zwischenkreises effektiv ins Stromnetz zurückspeisen kann. Die Netzsynchronisationsschaltung nutzt die Netzspannung als Synchronisationsfunktion. Um Totzoneneffekte während der Kommutierung zu vermeiden, werden die Schalter im selben Brückenzweig um 120 Grad geschaltet. Der logische Zusammenhang zwischen dem Netzsynchronisationssignal und dem Nulldurchgangssignal des Stromnetzes wird mittels eines Komparators ermittelt. Der Zusammenhang zwischen dem Netzsynchronisationssignal jedes Schaltgeräts und der Netzspannung wird durch eine Multisim-Simulation bestimmt. Jeder Schalter hat einen Schaltwinkel von 120 Grad und ist im Abstand von 60 Grad angeordnet. Zu jedem Zeitpunkt sind nur zwei Schaltleitungen in der Wechselrichterbrücke leitend, was einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Zudem arbeiten jeweils zwei Schalter im höchsten Spannungsbereich des Stromnetzes, was zu einem hohen Wirkungsgrad des Wechselrichters führt.
3. Spannungserkennungs-Steuerschaltung
Aufgrund der hohen Spannung auf der DC-Busseite des Aufzugsfrequenzumrichters ist es erforderlich, die Spannung zunächst mittels Widerständen zu teilen und anschließend die Busspannung mithilfe von Hall-Spannungssensoren zu isolieren und zu reduzieren, um sie in ein Niederspannungssignal umzuwandeln. Im Spannungserkennungs-Steuerkreis wird ein Hysterese-Tracking-Vergleichsregelungsverfahren eingesetzt. Dieses Verfahren ergänzt den Komparator um eine positive Rückkopplung und stellt dem Komparator zwei Vergleichswerte zur Verfügung: einen oberen und einen unteren Schwellenwert. Die hardwareseitig implementierte Regelung ist schnell und präzise. Der Spannungserkennungs-Steuerkreis verhindert nicht nur die kurzzeitige Überlagerung von Störsignalen mit dem Spannungssignal, die zu Schwankungen im Ausgangszustand des Komparators führen würde, sondern auch ein zu häufiges Ein- und Ausschalten des Energierückkopplungssystems.
4. Stromerkennungs-Steuerschaltung
Im Rahmen der Energierückführung muss der Strom die Leistungsanforderungen erfüllen. Die ins Netz zurückgespeiste Leistung muss mindestens der maximalen Leistung der Traktionsmaschine im Generatorbetrieb entsprechen, da sonst der Spannungsabfall am Zwischenkreis weiter ansteigt. Bei konstanter Netzspannung wird die Energierückführungsleistung des Systems durch den Rückführungsstrom bestimmt. Dieser muss zudem innerhalb des Nennbereichs des Wechselrichter-Leistungsschalters liegen. Die Reaktanzdrossel zwischen Netz und Wechselrichter ermöglicht hohe Ströme bei minimalem Drosselvolumen. Daher muss die Induktivität der Drossel gering sein, um die Energierückführung zu gewährleisten. Die Stromänderungsgeschwindigkeit ist sehr hoch. Durch die gleichzeitige Verwendung einer Stromhystereseregelung lässt sich der Rückführungsstrom effektiv steuern und Überstromereignisse verhindern.
5. Hauptsteuerkreis
Die zentrale Verarbeitungseinheit des Aufzugsenergierückgewinnungssystems ist die Hauptsteuerschaltung, die den Betrieb des gesamten Systems steuert. Die Hauptsteuerschaltung besteht aus einem Mikrocontroller und Peripherieschaltungen, die hochpräzise PWM-Signale auf Basis von Steueralgorithmen erzeugen. Die IPM-Fehlersteuerung gewährleistet mithilfe des Netzsynchronisationssignals die sichere und effektive Durchführung des gesamten Energierückgewinnungsprozesses.
6. Logische Schutzsteuerungsschaltung
Das Synchronisationssignal für den Netzanschluss, die Steuersignale für Spannung und Strom, das IPM-Fehlersignal und das Ansteuersignal des Hauptsteuerkreises müssen alle den Logikschutzsteuerkreis zur logischen Verarbeitung durchlaufen und werden schließlich an den Wechselrichterkreis zur Steuerung des Rückkopplungsprozesses weitergeleitet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Wechselstromausgabe des Wechselrichters mit dem Netz synchronisiert ist und gleichzeitig das Ansteuersignal bei Überstrom, Überspannung, Unterspannung oder IPM-Fehlern im Stromkreis blockiert wird, wodurch der Energierückkopplungsprozess gestoppt wird.
Da das Energierückgewinnungssystem des Aufzugs erst im Generatorbetrieb der Antriebsmaschine aktiv wird, ist seine Lebensdauer länger als die des Aufzugs selbst. Daraus lässt sich schließen, dass der Einsatz von Energierückgewinnungssystemen in Aufzügen – hinsichtlich ihrer Prinzipien, Energieeinsparungen und Leistungsfähigkeit – in der heutigen, zunehmend energieknappen Umwelt dringend gefördert werden sollte. Dies schafft nicht nur eine gesunde und umweltfreundliche Energiewirtschaft, sondern entspricht auch dem Aufruf von Staat und Regierung zur Energieeinsparung und Verbrauchsreduzierung sowie zum Aufbau einer umweltbewussten Gesellschaft und leistet somit einen Beitrag zu den nationalen Bemühungen um Energieeinsparung und Emissionsreduzierung.