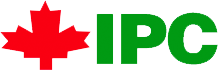Lieferanten von Frequenzumrichter-Zubehör weisen darauf hin, dass Motorfrequenzumrichter als Umrichtergeräte im Betrieb einen gewissen Stromverbrauch aufweisen. Dieser Stromverbrauch variiert je nach Last, Steuerungsmethode, Hersteller und Spezifikationen des Umrichters. Daten zeigen, dass der Stromverbrauch eines Frequenzumrichters etwa 4–5 % seiner Leistung beträgt. Davon entfallen ca. 50 % auf den Umrichter, ca. 40 % auf den Gleichrichter und die Gleichstromkreise und 5–15 % auf die Steuer- und Schutzschaltungen. Die 10°C-Regel besagt, dass sich die Zuverlässigkeit eines Geräts verdoppelt, wenn die Gerätetemperatur um 10°C sinkt. Daraus wird deutlich, wie wichtig es ist, den Temperaturanstieg von Frequenzumrichtern zu reduzieren, die Gerätezuverlässigkeit zu verbessern und somit die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, um der Gesellschaft einen besseren Nutzen zu bieten.
Die Wärmeabfuhr von Frequenzumrichtern kann in folgende Arten unterteilt werden: natürliche Wärmeabfuhr, Zwangsluftkühlung und Wasserkühlung.
Natürliche Wärmeableitung:
Frequenzumrichter mit geringer Leistung nutzen in der Regel natürliche Wärmeabfuhr. Ihr Betriebsumfeld sollte gut belüftet, staubfrei und frei von leicht anhaftenden Fremdkörpern sein. Typische Fremdkörper sind Klimaanlagenlüfter, Bearbeitungsmaschinen usw. Diese Umrichter zeichnen sich durch geringen Stromverbrauch und eine hervorragende Einsatzumgebung aus.
Darüber hinaus ist die Kapazität von Frequenzumrichtern mit natürlicher Wärmeabfuhr nicht immer gering. Bei Frequenzumrichtern mit geringer Kapazität kann ein Standard-Kühlkörper verwendet werden, wobei die Wärmeabfuhrfläche innerhalb der zulässigen Grenzen so groß wie möglich sein muss. Der Abstand zwischen den Kühlkörpern sollte gering sein, um die Wärmeabfuhrfläche zu maximieren. Bei Frequenzumrichtern mit hoher Kapazität empfiehlt sich bei Bedarf an natürlicher Wärmeabfuhr der Einsatz von Wärmerohrkühlern. Wärmerohrkühler stellen eine neue Generation von Kühlern dar, die Wärmerohr- und Kühlkörpertechnologie kombinieren. Sie zeichnen sich durch eine extrem hohe Wärmeabfuhreffizienz aus.
Zwangsluftkühlung:
Die Zwangsluftkühlung bezeichnet die direkte Kühlung des Gerätegehäuses durch einen oder mehrere externe Lüfter. Da Frequenzumrichter im Betrieb, insbesondere bei Dauerbetrieb unter Volllast und hohen Umgebungstemperaturen, zwangsläufig erhebliche Wärmemengen erzeugen, kann zur Vermeidung einer Überhitzung des Wechselrichters ein oder mehrere Lüfter zur direkten Kühlung des Gehäuses eingesetzt werden. Diese Kühlmethode ist kostengünstig, und die Anzahl der Lüfter kann zur Steigerung der Kühlleistung ohne Kostenberücksichtigung beliebig erhöht werden.
Wasserkühlung:
Wasserkühlungsradiatoren verfügen über einen Ein- und Auslass sowie mehrere Wasserkanäle im Inneren, die die Vorteile der Wasserkühlung optimal nutzen und so die Wärmeabfuhr maximieren. Dies ist das Grundprinzip wassergekühlter Radiatoren. Wasserkühlung ist eine gängige Methode der industriellen Kühlung. Bei Frequenzumrichtern wird sie jedoch aufgrund der hohen Kosten, der großen Abmessungen und der Tatsache, dass die Leistung gängiger Frequenzumrichter von mehreren tausend Voltampere bis hin zu fast 100 Kilovoltampere reicht, nur selten zur Wärmeabfuhr eingesetzt, da sie für Anwender oft unwirtschaftlich ist. Daher findet diese Methode nur in Ausnahmefällen und bei Frequenzumrichtern mit hoher Leistung Anwendung.
Unabhängig von der gewählten Wärmeabfuhrmethode sollte der Stromverbrauch des Motorfrequenzumrichters anhand seiner Kapazität ermittelt werden, um den passenden Lüfter und Kühlkörper für eine optimale Kosteneffizienz auszuwählen. Gleichzeitig müssen die Umgebungsbedingungen, denen Frequenzumrichter ausgesetzt sind, umfassend berücksichtigt werden. Entsprechende Maßnahmen sind zu ergreifen, um den ordnungsgemäßen und zuverlässigen Betrieb des Frequenzumrichters in anspruchsvollen Umgebungen wie hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, Kohlebergwerken, Ölfeldern und Offshore-Plattformen zu gewährleisten. Für den Frequenzumrichter selbst ist es ratsam, den Einfluss schädlicher Faktoren so weit wie möglich zu vermeiden. Beispielsweise kann er gegen Staub und Sand abgedichtet werden, und nur der Luftkanal des Kühlkörpers sollte mit der Außenluft in Kontakt stehen, um jegliche Beeinträchtigung des Inneren des Frequenzumrichters zu verhindern. Gegen Salznebel und Feuchtigkeit können alle Komponenten des Frequenzumrichters isoliert und beschichtet werden. Bei Frequenzumrichtern im Außeneinsatz sind Maßnahmen zum Schutz vor Regen, Sonne, Nebel und Staub zu treffen. In Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit können Klimaanlagen und weitere Geräte zur Kühlung und Entfeuchtung eingesetzt werden, um optimale Bedingungen für den Frequenzumrichter zu schaffen und dessen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Anschließend werden die Wärmeableitungswirkung und die Auswahlkriterien für Kühlkörper erörtert.