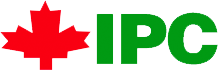Der Lieferant von Rückkopplungseinheiten weist darauf hin, dass Wechselstromgeneratoren seit der Einführung von automatischen Induktionsmotoren bereits über eine variable Frequenz verfügen. Durch Ändern der Generatordrehzahl lässt sich die Ausgangsfrequenz anpassen. Vor der Entwicklung von Hochgeschwindigkeitstransistoren war dies eine der wichtigsten Methoden zur Drehzahlregelung. Da die Generatordrehzahl jedoch die Ausgangsfrequenz und nicht die Spannung reduzierte, war die Frequenzvariation begrenzt.
Werfen wir also einen Blick auf die Komponenten des Frequenzumrichters und sehen wir uns an, wie diese zusammenarbeiten, um die Frequenz und die Motordrehzahl zu ändern.
Wechselrichterkomponenten - Gleichrichter
Da es schwierig ist, die Frequenz von Wechselstrom-Sinuswellen im Wechselstrombetrieb zu ändern, besteht die erste Aufgabe eines Frequenzumrichters darin, die Wellenform in Gleichstrom umzuwandeln. Um Wechselstrom zu erzeugen, ist die Gleichstromverarbeitung vergleichsweise einfach. Die erste Komponente jedes Frequenzumrichters ist ein Gleichrichter. Die Gleichrichterschaltung des Frequenzumrichters wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um und funktioniert im Prinzip wie ein Batterieladegerät oder ein Lichtbogenschweißgerät. Sie verwendet eine Diodenbrücke, um die Wechselstrom-Sinuswelle in eine Richtung zu begrenzen. Dadurch wird die vollständig gleichgerichtete Wechselstrom-Wellenform vom Gleichstromkreis als lokale Gleichstrom-Wellenform interpretiert. Ein dreiphasiger Frequenzumrichter verarbeitet drei unabhängige Wechselstrom-Eingangsphasen und wandelt sie in eine einzige Gleichstrom-Ausgangsphase um.
Die meisten Drehstrom-Frequenzumrichter können auch mit einphasiger Stromversorgung (230 V oder 460 V) betrieben werden. Da sie jedoch nur über zwei Eingangszweige verfügen, muss ihre Ausgangsleistung (PS) reduziert werden, da der erzeugte Gleichstrom proportional abnimmt. Ein echter Einphasen-Wechselrichter hingegen (ein Einphasen-Wechselrichter zur Steuerung eines Einphasenmotors) nutzt eine einphasige Eingangsspannung und erzeugt einen zum Eingang proportionalen Gleichstrom.
Es gibt zwei Gründe, warum Drehstrommotoren bei drehzahlvariablen Anwendungen häufiger eingesetzt werden als Einphasenmotoren. Erstens verfügen sie über einen größeren Leistungsbereich. Zweitens benötigen Einphasenmotoren in der Regel einen externen Eingriff, um in Gang zu treten.
Wechselrichterkomponenten – Gleichstrombus
Die zweite Komponente des DC-Zwischenkreises ist in Frequenzumrichtern nicht sichtbar, da sie deren Funktion nicht direkt beeinflusst. Hochwertige Allzweck-Frequenzumrichter verfügen jedoch stets über diesen Zwischenkreis. Er nutzt Kondensatoren und Induktivitäten, um die Wechselspannungswelligkeit der umgewandelten Gleichspannung zu filtern, bevor diese in den Wechselrichterbereich gelangt. Zusätzlich enthält er einen Filter zur Vermeidung von Oberwellenverzerrungen, die an die Wechselrichter-Stromversorgung zurückgeführt werden können. Ältere Frequenzumrichter benötigen hierfür separate Netzfilter.
Wechselrichterkomponenten - Wechselrichter
Auf der rechten Seite der Abbildung sind die inneren Komponenten des Frequenzumrichters dargestellt. Der Wechselrichter nutzt drei Gruppen von Hochgeschwindigkeitstransistoren, um dreiphasige Gleichstromimpulse zu erzeugen, die Wechselstrom-Sinuswellen simulieren. Diese Impulse bestimmen nicht nur die Spannung, sondern auch die Frequenz der Welle. Der Begriff „Wechselrichter“ bedeutet „Umkehrung“ und beschreibt die Auf- und Abwärtsbewegung der erzeugten Wellenform. Moderne Frequenzumrichter verwenden die Pulsweitenmodulation (PWM) zur Regelung von Spannung und Frequenz.
Kommen wir nun zum IGBT. IGBT steht für „Insulated Gate Bipolar Transistor“ und ist die Schaltkomponente (oder Impulskomponente) des Wechselrichters. Transistoren (die Elektronenröhren ersetzen) erfüllen in unserer Elektronik zwei Funktionen: Sie können als Verstärker fungieren und das Signal verstärken oder als Schalter das Signal ein- und ausschalten. Der IGBT ist eine moderne Variante, die höhere Schaltgeschwindigkeiten (3000–16000 Hz) ermöglicht und die Wärmeentwicklung reduziert. Eine höhere Schaltgeschwindigkeit verbessert die Genauigkeit der Wechselstromsimulation und verringert das Motorgeräusch. Durch die geringere Wärmeentwicklung kann der Kühlkörper kleiner ausfallen, wodurch der Frequenzumrichter weniger Platz benötigt.
Wechselrichter-PWM-Wellenform
Die vom Wechselrichter eines PWM-Wechselrichters erzeugte Wellenform im Vergleich zu einer echten Wechselstrom-Sinuswelle. Der Wechselrichterausgang besteht aus einer Reihe von Rechteckimpulsen mit fester Höhe und einstellbarer Breite.
In diesem speziellen Fall gibt es drei Impulsgruppen – eine breite Gruppe in der Mitte und eine schmale Gruppe am Anfang und Ende der positiven und negativen Hälfte des Wechselstromzyklus.
Die Summe der Impulsflächen entspricht der effektiven Spannung der Wechselstromwelle. Schneidet man die Impulsabschnitte oberhalb (oder unterhalb) der tatsächlichen Kommunikationswellenform ab und füllt die Fläche unterhalb der Kurve damit auf, so stellt man fest, dass sie nahezu perfekt übereinstimmen. Genau so kann der Frequenzumrichter die Motorspannung steuern. Die Summe aus Impulsbreite und Pausenbreite bestimmt die Frequenz der vom Motor wahrgenommenen Wellenform (daher PWM oder Pulsweitenmodulation). Ist der Impuls kontinuierlich (d. h. ohne Pausen), stimmt die Frequenz zwar ebenfalls, die Spannung ist jedoch deutlich höher als bei einer reinen Wechselstrom-Sinuswelle.
Der Frequenzumrichter passt entsprechend der benötigten Spannung und Frequenz die Höhe und Breite des Impulses sowie die Pausenbreite zwischen den Impulsen an. Mancher mag sich fragen, wie dieser vermeintliche Wechselstrom (eigentlich Gleichstrom) einen Drehstrom-Induktionsmotor betreiben kann.
Muss Wechselstrom im Motorrotor überhaupt einen Strom und ein entsprechendes Magnetfeld „induzieren“? Wechselstrom bewirkt naturgemäß eine Induktion, da sich seine Richtung ständig ändert, während Gleichstrom nach dem Einschalten des Stromkreises nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Wird der Gleichstrom jedoch ein- und ausgeschaltet, kann er Strom messen. Ältere Fahrzeuge (vor der Einführung der elektronischen Zündung) besaßen Zündanlagen mit Unterbrecherkontakten im Verteiler. Diese Kontakte dienten dazu, die Batterieimpulse an die Zündspulen (Transformatoren) weiterzuleiten. Dadurch wird in der Zündspule eine Ladung induziert und die Spannung so weit erhöht, dass die Zündkerze zünden kann. Der breite Gleichstromimpuls in der obigen Abbildung setzt sich aus Hunderten von Einzelimpulsen zusammen. Die Öffnungs- und Schließbewegung des Wechselrichterausgangs ermöglicht die Gleichstrominduktion.
Effektivspannung
Ein Faktor, der Wechselstrom so komplex macht, ist die ständige Spannungsänderung: von null auf eine maximale positive Spannung, dann wieder auf null, dann auf eine maximale negative Spannung und schließlich wieder auf null. Wie lässt sich die tatsächliche Spannung im Stromkreis bestimmen? Die Abbildung unten zeigt eine 60-Hz-Sinuswelle mit 120 V. Ihre Spitzenspannung beträgt jedoch 170 V. Wenn die tatsächliche Spannung 170 V beträgt, wie kann man dann von einer 120-V-Welle sprechen?
Ein Faktor, der Wechselstrom so komplex macht, ist seine ständige Spannungsänderung: von null auf eine maximale positive Spannung, dann zurück auf null, dann auf eine maximale negative Spannung und schließlich wieder auf null. Wie lässt sich die tatsächlich an den Stromkreis angelegte Spannung bestimmen?
Bei einer 60-Hz-Sinuswelle mit 120 V ist zu beachten, dass ihre Spitzenspannung 170 V beträgt. Wenn ihre tatsächliche Spannung 170 V beträgt, wie kann man sie dann als 120-V-Welle bezeichnen?
In einem Zyklus beginnt die Spannung bei 0 V, steigt auf 170 V und fällt dann wieder auf 0 V ab. Anschließend sinkt sie weiter auf -170 V und steigt dann erneut auf 0 V an. Die Fläche des grünen Rechtecks mit einer oberen Grenze von 120 V entspricht der Summe der Flächen des positiven und negativen Kurvenabschnitts.
120 V sind also der Durchschnittswert? Okay, wenn wir alle Spannungswerte an jedem Punkt während des gesamten Zyklus mitteln würden, ergäbe das ungefähr 108 V. Das kann also nicht die richtige Antwort sein. Warum misst das Multimeter dann 120 V? Das hängt mit der sogenannten „Effektivspannung“ zusammen.
Misst man die Wärmemenge, die durch Gleichstrom in einem Widerstand erzeugt wird, so stellt man fest, dass sie größer ist als die Wärmemenge, die durch den entsprechenden Wechselstrom erzeugt wird. Dies liegt daran, dass der Wert von Wechselstrom während des gesamten Zyklus nicht konstant bleibt. Unter kontrollierten Laborbedingungen führt ein bestimmter Gleichstrom zu einem Temperaturanstieg von 100 Grad, was einem Temperaturanstieg von 70,7 Grad bei entsprechendem Wechselstrom entspricht (70,7 % des Gleichstromwerts).
Der Effektivwert der Wechselspannung beträgt also 70,7 % der Gleichspannung. Man erkennt außerdem, dass der Effektivwert der Wechselspannung der Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate der Spannungen in der ersten Hälfte der Kurve entspricht. Wenn die Spitzenspannung 1 beträgt und verschiedene Spannungen zwischen 0° und 180° gemessen werden sollen, ist die Effektivspannung die Summe der Spitzenspannungen zwischen 0° und 70°. Das 0,707-fache der Spitzenspannung bei 170° in der Abbildung ergibt 120 V. Diese Effektivspannung wird auch als Effektivwert (RMS-Spannung) bezeichnet.
Daher beträgt die Spitzenspannung stets 1,414 der Effektivspannung. 230 V Wechselstrom haben eine Spitzenspannung von 325 V, während 460 V eine Spitzenspannung von 650 V aufweisen. Neben der Frequenzänderung muss der Frequenzumrichter die Spannung anpassen, selbst wenn diese unabhängig von der Drehzahl des Wechselstrommotors ist. Zwei 460-V-Wechselstrom-Sinuswellen sind dargestellt. Die rote Kurve entspricht 60 Hz, die blaue Kurve 50 Hz. Beide haben eine Spitzenspannung von 650 V, die Kurve mit 50 Hz ist jedoch deutlich breiter. Man erkennt leicht, dass die Fläche unter der Kurve (0–10 ms) größer ist als die Fläche unter der Kurve (0–8,3 ms) der Kurve mit 50 Hz. Da die Fläche unter der Kurve direkt proportional zur Effektivspannung ist, ist die Effektivspannung bei 50 Hz höher. Mit sinkender Frequenz verstärkt sich der Anstieg der Effektivspannung.
Werden 460-V-Motoren mit diesen höheren Spannungen betrieben, kann sich ihre Lebensdauer erheblich verkürzen. Daher muss der Frequenzumrichter die Spitzenspannung in Abhängigkeit von der Frequenz ständig anpassen, um eine konstante effektive Spannung zu gewährleisten. Je niedriger die Betriebsfrequenz, desto niedriger die Spitzenspannung und umgekehrt. Sie sollten nun das Funktionsprinzip des Frequenzumrichters und die Steuerung der Motordrehzahl gut verstehen. Die meisten Frequenzumrichter ermöglichen die manuelle Einstellung der Motordrehzahl über Mehrpositionsschalter oder Tastaturen oder die Automatisierung des Prozesses mithilfe von Sensoren (Druck, Durchfluss, Temperatur, Flüssigkeitsstand usw.).