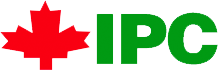Anbieter von Frequenzumrichter-Bremsanlagen weisen darauf hin, dass aufgrund der starken Förderung der Frequenzumrichtertechnologie und der intensiven Werbung der Anbieter einige Industrieunternehmen den Einsatz von Frequenzumrichtern unbewusst mit Energieeinsparung und Stromersparnis gleichsetzen. In der Praxis zeigt sich jedoch aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten, dass nicht überall, wo Frequenzumrichter eingesetzt werden, Energie und Strom eingespart werden können. Woran liegt das und welche Missverständnisse bestehen in der Öffentlichkeit bezüglich Frequenzumrichtern?
1. Der Frequenzumrichter kann bei Verwendung mit allen Motortypen Strom sparen.
Ob ein Frequenzumrichter Energieeinsparungen ermöglicht, hängt von den Drehzahlregelungseigenschaften seiner Last ab. Bei Kreiselmaschinen, Ventilatoren und Wasserpumpen, die zu den Lasten mit quadratischem Drehmoment zählen, müssen die Bedingungen P ∝ T<sup>n</sup> und P ∝ n<sup>3</sup> erfüllt sein, d. h. die Ausgangsleistung an der Motorwelle ist proportional zur dritten Potenz der Drehzahl. Daher ist der Energiespareffekt von Frequenzumrichtern bei Lasten mit quadratischem Drehmoment am deutlichsten.
Bei Lasten mit konstantem Drehmoment, wie beispielsweise Roots-Gebläsen, ist das Drehmoment drehzahlunabhängig. Üblicherweise wird ein Auslass installiert und über ein Ventil gesteuert. Übersteigt das Luftvolumen den Bedarf, wird überschüssige Luft abgelassen, um die Einstellung zu erreichen. In diesem Fall kann die Drehzahlregelung genutzt werden, was auch Energieeinsparungen ermöglicht. Bei Lasten mit konstanter Leistung ist die Leistung ebenfalls drehzahlunabhängig. Hier ist kein Frequenzumrichter erforderlich.
2. Fehlvorstellungen über falsche Methoden bei der Berechnung des Energieverbrauchs
Viele Unternehmen nutzen bei der Berechnung der Energieeinsparung häufig die Blindleistungskompensation auf Basis der Scheinleistung. Beispielsweise beträgt der gemessene Betriebsstrom eines Motors unter Volllastbedingungen bei Netzfrequenz 194 A. Durch den Einsatz einer frequenzgesteuerten Drehzahlregelung erhöht sich der Leistungsfaktor im Volllastbetrieb auf etwa 0,99. Der gemessene Strom liegt dann bei 173 A. Die Stromreduzierung ist darauf zurückzuführen, dass der interne Filterkondensator des Frequenzumrichters den Leistungsfaktor des Systems verbessert.
Gemäß der Berechnung der Scheinleistung ergibt sich folgender Energiespareffekt:
ΔS=UI=380×(194-173)=7,98kVA
Der Energiespareffekt beträgt etwa 11 % der Nennleistung des Motors.
Tatsächlich ist die Scheinleistung S das Produkt aus Spannung und Stromstärke. Bei gleicher Spannung ändert sich die Scheinleistung proportional zur Stromstärke. Aufgrund der Systemreaktanz im Stromkreis entspricht die Scheinleistung nicht der tatsächlichen Leistungsaufnahme des Motors, sondern der maximalen Ausgangsleistung unter idealen Bedingungen. Die tatsächliche Leistungsaufnahme des Motors wird üblicherweise als Wirkleistung angegeben.
Der tatsächliche Leistungsverbrauch eines Motors hängt vom Motor und seiner Last ab. Nach der Erhöhung des Leistungsfaktors ändert sich weder die Last noch der Wirkungsgrad des Motors. Daher bleibt auch der tatsächliche Leistungsverbrauch unverändert. Der Betriebszustand des Motors, der Statorstrom sowie die Wirk- und Blindströme blieben nach der Erhöhung des Leistungsfaktors gleich. Wie lässt sich also der Leistungsfaktor verbessern? Der Grund liegt im Filterkondensator des Frequenzumrichters. Ein Teil des Motorverbrauchs ist die vom Filterkondensator erzeugte Blindleistung. Die Verbesserung des Leistungsfaktors reduziert den tatsächlichen Eingangsstrom des Frequenzumrichters und damit auch die Leitungs- und Transformatorverluste im Stromnetz. Obwohl in der obigen Berechnung der tatsächliche Strom verwendet wurde, wurde die Scheinleistung anstelle der Wirkleistung berechnet. Daher ist die Berechnung von Energieeinsparungen anhand der Scheinleistung nicht korrekt.
Als elektronische Schaltung verbraucht der Frequenzumrichter selbst ebenfalls Strom.
Aus dem Aufbau des Frequenzumrichters geht hervor, dass dieser selbst elektronische Schaltungen enthält und daher im Betrieb ebenfalls Strom verbraucht. Obwohl sein Verbrauch im Vergleich zu Hochleistungsmotoren geringer ist, ist er dennoch messbar. Expertenberechnungen zufolge liegt der maximale Eigenverbrauch eines Frequenzumrichters bei etwa 3–5 % seiner Nennleistung. Eine 1,5-PS-Klimaanlage verbraucht 20–30 Watt, was etwa dem Stromverbrauch einer Dauerleuchte entspricht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frequenzumrichter im Netzfrequenzbetrieb energiesparende Funktionen aufweisen. Voraussetzung dafür ist jedoch: Erstens eine hohe Leistung und die Nutzung als Lüfter-/Pumpenlast; zweitens eine energiesparende Funktion des Geräts (per Software); drittens ein langfristiger Dauerbetrieb. Unter diesen drei Bedingungen kann ein Frequenzumrichter seine Energiesparwirkung unter Beweis stellen.
Energieeinsparung und Verbrauchsreduzierung sind seit jeher Ziele und Prinzipien der Fertigungsindustrie. Für Industrieunternehmen ist es jedoch unerlässlich zu verstehen, unter welchen Umständen Frequenzumrichter eingesetzt werden sollten, in welchen Situationen ihr Einsatz ungeeignet ist und die Gesamtkonfiguration der Umrichter umfassend zu betrachten. Die durch eine übermäßige Konfiguration von Frequenzumrichtern verursachten Oberwellenrisiken sind allgemein anerkannt. Daher ist ein sachgemäßer Einsatz von Frequenzumrichtern notwendig, um die Strategie der Energieeinsparung, Verbrauchsreduzierung und nachhaltigen Entwicklung tatsächlich zu erreichen.