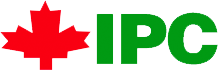Anbieter von Energierückkopplungseinheiten weisen darauf hin, dass Frequenzumrichter bei der Inbetriebnahme und im Betrieb häufig verschiedene Probleme aufweisen, wobei Überspannung am häufigsten auftritt. Tritt eine Überspannung auf, wird zum Schutz der internen Schaltung die Überspannungsschutzfunktion des Frequenzumrichters aktiviert, was zum Abschalten des Umrichters und damit zu einem Fehlbetrieb des Geräts führt.
Daher müssen Maßnahmen ergriffen werden, um Überspannungen zu beseitigen und Störungen vorzubeugen. Aufgrund der unterschiedlichen Einsatzszenarien von Frequenzumrichtern und Motoren variieren auch die Ursachen für Überspannungen, weshalb je nach Situation entsprechende Maßnahmen erforderlich sind.
Entstehung von Überspannungen im Frequenzumrichter und regenerative Bremsung
Die sogenannte Überspannung eines Frequenzumrichters bezeichnet die Situation, in der die Spannung des Frequenzumrichters aus verschiedenen Gründen die Nennspannung überschreitet, was sich hauptsächlich in der Gleichspannung des Gleichstromzwischenkreises des Frequenzumrichters manifestiert.
Im Normalbetrieb entspricht die Gleichspannung des Frequenzumrichters dem Mittelwert nach dreiphasiger Vollweggleichrichtung. Bei einer Netzspannung von 380 V ergibt sich eine mittlere Gleichspannung von Ud = 1,35 U<sub>Leitung</sub> = 513 V.
Bei Überspannung wird der Energiespeicherkondensator am Gleichstromzwischenkreis geladen. Sobald die Spannung auf etwa 700 V ansteigt (modellabhängig), wird der Überspannungsschutz des Frequenzumrichters aktiviert.
Es gibt zwei Hauptgründe für Überspannungen in Frequenzumrichtern: Leistungsüberspannung und regenerative Überspannung.
Überspannung im Versorgungsnetz bezeichnet den Fall, dass die Gleichspannung im Zwischenkreis aufgrund einer zu hohen Versorgungsspannung den Nennwert überschreitet. Heutzutage erreichen die Eingangsspannungen der meisten Frequenzumrichter bis zu 460 V, sodass Überspannungen durch das Versorgungsnetz äußerst selten sind.
Das Hauptthema dieses Artikels ist die Rückgewinnung von Überspannung.
Die Hauptgründe für die Entstehung von regenerativer Überspannung sind folgende: Wenn die Last von GD2 (Schwungraddrehmoment) abbremst, ist die vom Frequenzumrichter eingestellte Verzögerungszeit zu kurz;
Der Motor ist im abgesenkten Zustand äußeren Kräften (z. B. Ventilatoren und Spannmaschinen) oder potenziellen Lasten (z. B. Aufzügen und Kränen) ausgesetzt. Dadurch ist seine tatsächliche Drehzahl höher als die vom Frequenzumrichter vorgegebene Drehzahl, was bedeutet, dass die Rotordrehzahl die Synchrondrehzahl übersteigt. In diesem Fall ist der Schlupf des Motors negativ, und die Drehrichtung der Rotorwicklung im Magnetfeld ist der Drehrichtung des Motors entgegengesetzt. Das dadurch erzeugte elektromagnetische Drehmoment wirkt als Bremsmoment der Drehrichtung entgegen. Der Elektromotor befindet sich somit im Generatorbetrieb, und die kinetische Energie der Last wird in elektrische Energie umgewandelt.
Die regenerative Energie wird über die Freilaufdiode des Wechselrichters in dessen Gleichstromspeicherkondensator geladen, wodurch die Zwischenkreisspannung ansteigt – eine sogenannte regenerative Überspannung. Das dabei entstehende Drehmoment wirkt dem ursprünglichen Drehmoment entgegen und stellt das Bremsmoment dar. Daher entspricht die regenerative Überspannung gleichzeitig dem regenerativen Bremsvorgang.
Anders ausgedrückt: Durch die Eliminierung der Rückgewinnungsenergie erhöht sich das Bremsmoment. Ist die Rückgewinnungsenergie gering, verfügen Wechselrichter und Motor selbst über eine Bremskraft von 20 %, wobei dieser Teil der elektrischen Energie von Wechselrichter und Motor verbraucht wird. Übersteigt diese Energie die Aufnahmekapazität von Frequenzumrichter und Motor, wird der Kondensator des Gleichstromkreises überladen, und die Überspannungsschutzfunktion des Frequenzumrichters wird aktiviert, was zum Betriebsstopp führt. Um dies zu vermeiden, muss diese Energie rechtzeitig abgeführt werden, wodurch gleichzeitig das Bremsmoment erhöht wird – genau das ist der Zweck der Bremsenergierückgewinnung.
Maßnahmen zur Vermeidung von Überspannungen an Frequenzumrichtern
Aufgrund unterschiedlicher Überspannungsursachen variieren auch die ergriffenen Maßnahmen. Bei Überspannungen während des Parkvorgangs kann, sofern keine besonderen Anforderungen an Parkzeit oder -ort bestehen, die Verzögerungszeit des Frequenzumrichters verlängert oder ein Freilauf durchgeführt werden. Beim Freilauf trennt der Frequenzumrichter den Hauptschalter, sodass der Motor frei ausrollen und zum Stillstand kommen kann.
Wenn bestimmte Anforderungen an die Parkzeit oder den Parkort bestehen, kann die Gleichstrombremsfunktion genutzt werden.
Die Gleichstrombremsfunktion besteht darin, den Motor auf eine bestimmte Frequenz abzubremsen und dann Gleichstrom an die Statorwicklung des Motors anzulegen, um ein statisches Magnetfeld zu erzeugen.
Die Rotorwicklung des Motors durchschneidet das Magnetfeld und erzeugt ein Bremsmoment, das die kinetische Energie der Last in elektrische Energie umwandelt und diese in Form von Wärme im Rotorkreis des Motors verbraucht. Daher wird diese Art des Bremsens auch als energieverbrauchendes Bremsen bezeichnet. Der Bremsvorgang bei Gleichstrom umfasst zwei Prozesse: regeneratives Bremsen und energieverbrauchendes Bremsen. Dieses Bremsverfahren erreicht einen Wirkungsgrad von nur 30–60 % des regenerativen Bremsens, und das Bremsmoment ist relativ gering. Da der Energieverbrauch im Motor zu Überhitzung führen kann, sollte die Bremszeit nicht zu lang sein.
Darüber hinaus werden Anlauffrequenz, Bremszeit und Bremsspannung der Gleichstrombremse manuell eingestellt und können nicht automatisch anhand der Rekuperationsspannung angepasst werden. Daher kann die Gleichstrombremse nicht zur Überspannung im Normalbetrieb eingesetzt werden, sondern nur zum Bremsen im Stand.
Die durch das zu hohe Schwungraddrehmoment (GD2) der Last beim Abbremsen (von hoher auf niedrige Drehzahl ohne Stillstand) verursachte Überspannung kann durch eine entsprechende Verlängerung der Abbremszeit behoben werden. Dieses Verfahren nutzt das Prinzip der regenerativen Bremsung. Die Verlängerung der Abbremszeit steuert die Ladegeschwindigkeit des Wechselrichters über die Rückspeisungsspannung der Last und nutzt so dessen Bremsleistung optimal aus. Bei Lasten, die den Motor aufgrund externer Kräfte (einschließlich potenzieller Energiefreisetzung) in den regenerativen Zustand versetzen, ist die Rückspeisungsenergie zu hoch, um vom Frequenzumrichter selbst verbraucht zu werden, da diese im Normalbetrieb bremsen. Daher ist eine Gleichstrombremsung oder eine Verlängerung der Abbremszeit nicht möglich.
Im Vergleich zur Gleichstrombremsung bietet die regenerative Bremsung ein höheres Bremsmoment. Dessen Größe lässt sich vom Bremsaggregat des Frequenzumrichters automatisch an das benötigte Bremsmoment der Last (d. h. den Grad der zurückgewonnenen Energie) anpassen. Daher eignet sich die regenerative Bremsung optimal zur Bereitstellung des Bremsmoments für die Last im Normalbetrieb.
Verfahren der regenerativen Bremsung durch Frequenzumwandlung:
1. Energieverbrauchender Typ:
Bei diesem Verfahren wird ein Bremswiderstand parallel zum Gleichstromkreis eines Frequenzumrichters geschaltet. Die Steuerung eines Leistungstransistors erfolgt durch Messung der Zwischenkreisspannung. Sobald die Zwischenkreisspannung auf etwa 700 V ansteigt, leitet der Leistungstransistor und gibt die zurückgewonnene Energie an den Widerstand ab, wo sie in Form von Wärme verbraucht wird. Dadurch wird ein weiterer Anstieg der Zwischenkreisspannung verhindert. Da die zurückgewonnene Energie nicht genutzt werden kann, zählt dieses Verfahren zu den Energieverbrauchern. Im Gegensatz zur Gleichstrombremsung wird die Energie bei diesem Verfahren außerhalb des Motors am Bremswiderstand verbraucht. Dadurch wird eine Überhitzung des Motors vermieden und ein häufigerer Betrieb ermöglicht.
2. Paralleler Gleichstrom-Bus-Absorptionstyp:
Geeignet für Mehrmotorenantriebe (z. B. Streckmaschinen), bei denen jeder Motor einen Frequenzumrichter benötigt, mehrere Frequenzumrichter einen netzseitigen Umrichter gemeinsam nutzen und alle Wechselrichter parallel an einen gemeinsamen Gleichstromzwischenkreis angeschlossen sind. In diesem System arbeiten häufig ein oder mehrere Motoren im Bremszustand. Der bremsende Motor wird von anderen Motoren mitgezogen, um Bremsenergie zu erzeugen, die dann vom laufenden Motor über einen parallelen Gleichstromzwischenkreis aufgenommen wird. Kann die Bremsenergie nicht vollständig aufgenommen werden, wird sie über einen gemeinsamen Bremswiderstand verbraucht. Die dabei erzeugte Bremsenergie wird teilweise genutzt, aber nicht ins Stromnetz zurückgespeist.
3. Art der Energierückkopplung:
Der netzseitige Wechselrichter mit Energierückführung ist reversibel. Wird Rückspeisungsenergie erzeugt, speist der reversible Wechselrichter diese ins Netz zurück und ermöglicht so deren vollständige Nutzung. Dieses Verfahren erfordert jedoch eine hohe Stabilität der Stromversorgung. Bei einem plötzlichen Stromausfall kann es zu einer Umkehrung und einem Umschalten kommen.