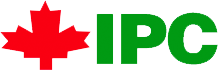Der Lieferant der Bremsanlage für Frequenzumrichter weist darauf hin, dass der Frequenzumrichter über zahlreiche Einstellparameter mit jeweils einem bestimmten Einstellbereich verfügt. Im Betrieb kann es häufig vorkommen, dass der Frequenzumrichter aufgrund falscher Parametereinstellungen nicht ordnungsgemäß funktioniert. Daher ist es unerlässlich, die relevanten Parameter korrekt einzustellen.
1. Kontrollmethode:
Das heißt, Drehzahlregelung, Drehmomentregelung, PID-Regelung oder andere Verfahren. Nach der Wahl des Regelungsverfahrens ist es in der Regel erforderlich, eine statische oder dynamische Identifizierung basierend auf der Regelungsgenauigkeit durchzuführen.
2. Minimale Betriebsfrequenz:
Die Mindestdrehzahl, bei der der Motor arbeitet. Bei niedrigen Drehzahlen ist die Wärmeabfuhr des Motors unzureichend, und ein dauerhafter Betrieb mit niedriger Drehzahl kann zum Durchbrennen des Motors führen. Außerdem steigt bei niedrigen Drehzahlen der Strom im Kabel, was zu einer Erwärmung des Kabels führen kann.
3. Maximale Betriebsfrequenz:
Die maximale Frequenz eines typischen Frequenzumrichters beträgt bis zu 60 Hz, manche sogar bis zu 400 Hz. Hohe Frequenzen führen zu hohen Motordrehzahlen. Bei herkömmlichen Motoren können die Lager nicht dauerhaft mit Nenndrehzahl betrieben werden. Hält der Rotor dieser Zentrifugalkraft stand?
4. Trägerfrequenz:
Je höher die Trägerfrequenz eingestellt ist, desto größer sind die Oberwellenanteile höherer Ordnung, was eng mit Faktoren wie Kabellänge, Motorerwärmung, Kabelerwärmung und Frequenzumrichtererwärmung zusammenhängt.
5. Motorparameter:
Der Frequenzumrichter legt die Leistung, den Strom, die Spannung, die Drehzahl und die maximale Frequenz des Motors in den Parametern fest, die direkt vom Typenschild des Motors abgelesen werden können.
6. Frequenzsprungverfahren:
Bei einer bestimmten Frequenz kann es zu Resonanz kommen, insbesondere wenn das gesamte Gerät relativ hoch ist; Vermeiden Sie beim Steuern des Kompressors den Pumppunkt des Kompressors.
7. Beschleunigungs- und Verzögerungszeit
Die Beschleunigungszeit bezeichnet die Zeit, die die Ausgangsfrequenz benötigt, um von 0 auf die Maximalfrequenz anzusteigen, während die Verzögerungszeit die Zeit bezeichnet, die die Ausgangsfrequenz benötigt, um von der Maximalfrequenz auf 0 abzufallen. Üblicherweise werden Beschleunigungs- und Verzögerungszeit durch das Ansteigen und Abfallen des Frequenzeinstellsignals bestimmt. Während der Motorbeschleunigung muss die Anstiegsgeschwindigkeit der Frequenzeinstellung begrenzt werden, um einen Überstrom zu vermeiden, und während der Verzögerung muss die Abfallgeschwindigkeit begrenzt werden, um eine Überspannung zu verhindern.
Anforderungen an die Beschleunigungszeit: Der Beschleunigungsstrom muss unterhalb der Überstromkapazität des Frequenzumrichters liegen, um ein Abschalten des Frequenzumrichters aufgrund von Überstromblockierung zu vermeiden. Bei der Einstellung der Verzögerungszeit ist darauf zu achten, dass die Spannung im Glättungskreis nicht zu hoch wird und die Rückspeisungsüberspannung nicht blockiert, was ein Abschalten des Frequenzumrichters zur Folge haben könnte. Die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit kann lastabhängig berechnet werden. In der Praxis empfiehlt es sich jedoch, zunächst längere Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten basierend auf der Last und Erfahrungswerten einzustellen und durch Starten und Stoppen des Motors zu beobachten, ob Überstrom- oder Überspannungsalarme auftreten. Anschließend sollten die Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten schrittweise verkürzt werden, solange keine Alarme auftreten. Dieser Vorgang sollte mehrmals wiederholt werden, um die optimale Beschleunigungs- und Verzögerungszeit zu ermitteln.
8. Drehmomentsteigerung
Die auch als Drehmomentkompensation bekannte Methode erhöht den Niederfrequenzbereich f/V, um den durch den Widerstand der Motorstatorwicklung verursachten Drehmomentabfall bei niedrigen Drehzahlen auszugleichen. Im Automatikmodus wird die Spannung während der Beschleunigung automatisch erhöht, um das Anlaufdrehmoment zu kompensieren und so ein sanftes Anfahren des Motors zu ermöglichen. Bei manueller Kompensation wird die optimale Kennlinie anhand der Lastcharakteristik, insbesondere der Anlaufcharakteristik, durch Tests ermittelt. Bei Lasten mit variablem Drehmoment kann eine falsche Auswahl zu einer hohen Ausgangsspannung bei niedrigen Drehzahlen, unnötigem Energieverbrauch und sogar zu einem hohen Anlaufstrom beim Anfahren des Motors unter Last ohne Drehzahlerhöhung führen.
9. Elektronischer thermischer Überlastungsschutz
Diese Funktion schützt den Motor vor Überhitzung. Sie berechnet den Temperaturanstieg des Motors anhand des Betriebsstroms und der Frequenz mithilfe der CPU im Frequenzumrichter und gewährleistet so den Überhitzungsschutz. Diese Funktion ist nur bei 1:1-Konfigurationen anwendbar. Bei 1:n-Konfigurationen müssen an jedem Motor Thermorelais installiert werden.
Einstellwert für den elektronischen thermischen Schutz (%)=[Nennstrom des Motors (A)/Nennausgangsstrom des Frequenzumrichters (A)] × 100%.
10. Frequenzbegrenzung
Die obere und untere Grenzamplitude der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters. Die Frequenzbegrenzung dient als Schutzfunktion, um Fehlbedienungen oder Ausfälle der externen Frequenzeinstellungsquelle zu verhindern, die zu einer zu hohen oder zu niedrigen Ausgangsfrequenz führen können. Dadurch werden Schäden am Gerät vermieden. Die Einstellung erfolgt anwendungsbezogen. Diese Funktion kann auch als Geschwindigkeitsbegrenzung genutzt werden. Bei manchen Förderbändern mit begrenzter Fördermenge kann ein Frequenzumrichter eingesetzt werden, um den mechanischen Verschleiß und den Verschleiß des Förderbandes zu reduzieren. Die obere Grenzfrequenz des Frequenzumrichters kann auf einen bestimmten Wert eingestellt werden, sodass das Förderband mit einer festen und reduzierten Arbeitsgeschwindigkeit betrieben werden kann.
11. Vorspannungsfrequenz
Manche dieser Funktionen werden auch als Frequenzabweichung oder Frequenzabweichungseinstellung bezeichnet. Sie dienen dazu, die Ausgangsfrequenz anzupassen, wenn die Frequenz durch ein externes analoges Signal (Spannung oder Strom) vorgegeben wird. Mit dieser Funktion lässt sich die niedrigste Ausgangsfrequenz des Frequenzeinstellsignals festlegen. Einige Frequenzumrichter können im Bereich von 0 bis f<sub>max</sub> arbeiten, wenn das Frequenzeinstellsignal 0 % beträgt. Einige Frequenzumrichter (z. B. von Mingdian und Sanken) ermöglichen zudem die Einstellung der Vorspannungspolarität. Falls die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters während der Fehlersuche bei einem Frequenzeinstellsignal von 0 % nicht 0 Hz, sondern x Hz beträgt, kann durch Einstellen der Vorspannungsfrequenz auf -x Hz die Ausgangsfrequenz auf 0 Hz korrigiert werden.
12. Frequenzeinstellung Signalverstärkung
Diese Funktion ist nur bei der Frequenzeinstellung mit einem externen Analogsignal wirksam. Sie dient dem Ausgleich der Differenz zwischen der externen Sollspannung des Signals und der internen Spannung (+10 V) des Frequenzumrichters. Gleichzeitig ermöglicht sie die einfache Simulation der Signalspannungseinstellungen. Bei der Einstellung wird, wenn das analoge Eingangssignal seinen Maximalwert erreicht (z. B. 10 V, 5 V oder 20 mA), der prozentuale Frequenzanteil berechnet, der als f/V-Grafik ausgegeben werden kann, und als Parameter für die Einstellung verwendet. Beträgt das externe Sollsignal 0–5 V und die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters 0–50 Hz, kann die Signalverstärkung auf 200 % eingestellt werden.
13. Drehmomentbegrenzung
Das System lässt sich in zwei Arten unterteilen: Drehmomentbegrenzung für den Antrieb und Drehmomentbegrenzung für das Bremsen. Die Drehmomentberechnung erfolgt über die CPU anhand der Ausgangsspannungs- und Stromwerte des Frequenzumrichters. Dies verbessert das Erholungsverhalten bei Stoßlasten während Beschleunigung, Verzögerung und Betrieb mit konstanter Drehzahl deutlich. Die Drehmomentbegrenzungsfunktion ermöglicht eine automatische Beschleunigungs- und Verzögerungssteuerung. Sofern die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit kürzer als die Lastträgheitszeit ist, wird zudem sichergestellt, dass der Motor automatisch entsprechend dem eingestellten Drehmomentwert beschleunigt und verzögert.
Die Anlaufdrehmomentfunktion sorgt für ein hohes Anlaufdrehmoment. Im stationären Betrieb regelt sie den Motorschlupf und begrenzt das Motordrehmoment auf den eingestellten Maximalwert. Selbst bei zu kurzer Anlaufzeit und plötzlichem Anstieg des Lastdrehmoments löst der Frequenzumrichter nicht aus. In diesem Fall überschreitet das Motordrehmoment den eingestellten Maximalwert nicht. Ein hohes Anlaufdrehmoment ist für den Anlauf vorteilhaft, daher empfiehlt sich eine Einstellung auf 80–100 %.
Je kleiner der eingestellte Wert des Bremsmoments, desto größer die Bremskraft. Dies ist vorteilhaft bei schnellen Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgängen. Ist der eingestellte Wert des Bremsmoments zu hoch, kann eine Überspannungswarnung ausgelöst werden. Bei einem Bremsmoment von 0 % ist die dem Hauptkondensator zugeführte Rekuperationsenergie nahezu null, sodass der Motor ohne Bremswiderstand bis zum Stillstand abbremsen kann und keine Abschaltung erfolgt. Bei bestimmten Lasten, beispielsweise bei einem Bremsmoment von 0 %, kann es jedoch während der Verzögerung zu einem kurzen Leerlauf kommen. Dies führt zu wiederholten Anläufen des Frequenzumrichters und starken Stromschwankungen. Im Extremfall kann dies zum Abschalten des Frequenzumrichters führen, was unbedingt zu beachten ist.